Römische Mosaiken
Seit dem vorletzten Jahrhundert wurden in Griechenland zahlreiche
Bodenmosaiken ausgegraben, die aufgrund der Fundsituation, sowie ihrer technischen
und stilistischen Eigenart der römischen Kaiserzeit (1.-4. Jh.n.Chr.)
zuzuweisen sind. Es handelt sich um Böden, die aus sog. Tessellae,
quadratisch zugeschnittenen Würfeln aus Marmor, Kalkstein, Glas oder
Terrakotta bestehen.

Griechenland war während der römischen Kaiserzeit ein relativ
armes Land. Der Reichtum konzentrierte sich in den Händen einer Minderheit,
die eng mit den Römern zusammenarbeitete.
Zu dieser Elite gehörte
etwa der herausragende Rhetor und Multimillionär Herodes Atticus,
der im 2. Jh.n.Chr. in Athen lebte und zahlreiche Prestigebauten in ganz
Griechenland errichten ließ.
In einigen Städten wie Thessaloniki, Korinth und Patras blühte
der Handel, von dem allerdings nur eine kleine Oberschicht profitierte.
Diese reichen Kaufleute, hauptsächlich Griechen mit römischem
Bürgerrecht oder Römer, konnten sich luxuriöse Häuser
in der Stadt oder auf dem Lande leisten.In Griechenland scheint es nur
wenige Privatbauten gegeben zu haben, die so groß, prächtig
und aufwendig waren wie die palastartigen Anlagen in Italien und Nordafrika.
Bei den meisten bisher bekannten Wohnhäusern handelt es sich um recht
einfache, klar gegliederte Bauten, die sich, trotz ihrer teuren Ausstattung,
nicht über ein größeres Areal auszudehnen scheinen.
In
den letzten Jahrzehnten wurden über 200 Gebäude mit Mosaikausstattung
ausgegraben. Es handelt sich vorwiegend um Badeanlagen (Thermen) oder
Wohnhäuser. Bei zahlreichen Bauten läßt sich ihre genaue
Funktion nicht mehr ermitteln, da sie entweder zum großen Teil zerstört
sind, oder nicht vollständig ausgegraben werden konnten. Insbesondere
bei sog. Rettungsgrabungen in dicht besiedelten Städten, wie beispielsweise
Athen und Patras, wo nur auf einem begrenzten Grundstück gegraben
werden darf, läßt sich die ursprüngliche Ausdehnung eines
Wohnkomplexes nur selten feststellen.
Natürlich stellt sich immer wieder die Frage, ob der Fußbodendekor
Hinweise auf die Funktion eines Raumes geben kann.
Im kaiserzeitlichen Griechenland
konzentriert sich der Ausstattungsluxus vorwiegend auf überdachte Räume,
die am Wohnhof oder Peristyl liegen. In einigen Fällen legen Raumgröße,
Anlage und Thema des Mosaiks eine Deutung als Cubiculum (Schlafraum), Triclinium
(Speisezimmer mit drei Liegestätten) oder größeren Bankettsaal
nahe.
Triclinia sind häufig am Aufbau ihres Mosaikbodens zu erkennen. Die
mit Figuren oder ornamentalen Motiven geschmückten Felder sind in der
Regel T-förmig angeordnet und werden an drei Seiten von schlichten
geometrischen Mustern oder Plattenböden gerahmt. Eine derartige Komposition
begegnet uns beispielsweise im 5.5 x 6.25m großen Triclinium im sog.
Haus des Menander in Mytilene.
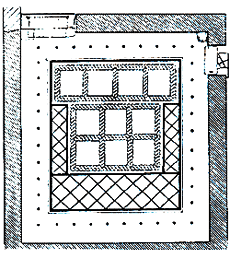
Das Mosaik ist durch einfache Flechtbänder in zehn quadratische
"Kassetten" unterteilt. In den Feldern sind entweder dreifigurige Theaterszenen
oder menschliche Büsten dargestellt. Alle Bilder sind nach Norden,
auf die Rückwand des Zimmers ausgerichtet. Die inhaltlich bedeutsamsten
Darstellungen (Büsten des Komödiendichters Menander und der Muse
Thalia) liegen unmittelbar vor den beiden Eingängen an der Südseite
des Tricliniums.
Die T-förmige Komposition wird an drei Seiten von
einem einfachen Quadratmuster eingefaßt, so daß sich ein rechteckiger
Teppich ergibt. Der äußere Rahmen des Mosaikbodens besteht schließlich
aus einem breiten weißen Band mit einer Reihe von kleinen Kreuzsternen
in der Mitte.
Oft werden prachtvoll ausgestattete Räume als Andrones
oder Oikoi gedeutet. In den uns überlieferten antiken Quellen sind
allerdings keine konkreten Hinweise auf das Aussehen von derartigen Speisesälen
während der Kaiserzeit zu finden.
Da von der ursprünglichen Raumausstattung
in der Regel außer Boden- und Wandschmuck nichts mehr erhalten ist,
gehen die Ausgräber bei ihrer Interpretation in erster Linie von der
Komposition und dem figürlichen Dekor der Mosaiken aus.
Die Mosaikbilder
(Stilleben, Personifikationen der Jahreszeiten, dionysischer Thiasos) werden
als Anspielungen auf eine reich gedeckte Tafel verstanden. Nur selten geben
sie jedoch eine konkrete Auskunft über die Nutzung des Raumes. Dionysos-Bacchus
und sein Gefolge waren während der Kaiserzeit besonders beliebt, da
sie vollkommenen Lebensgenuß, Reichtum und Fruchtbarkeit verkörperten.
Dionysos bringt als Gott des Weines Berauschtheit und Ekstase. Sein Gefolge
aus Satyrn, Eroten und halbnackten Mänaden unterstreicht das erotische
Element. Aus diesem Grund sind die Darstellungen in erster Linie als Ausdruck
hedonistischen Lebensgefühls zu verstehen.
Es erscheint selbstverständlich,
daß Zimmer mit einer aufwendigen Mosaikausstattung einen höheren
Stellenwert hatten als beispielsweise schmucklose Kammern, die mit groben
Estrichböden versehen waren. Insbesondere bei größeren Mosaikräumen
muß damit gerechnet werden, daß sie repräsentativen Zwecken
dienten und als Empfangs- oder Bankettsäle genutzt wurden.
Problematisch
wird allerdings die Funktionszuweisung, wenn ein Haus über mehrere
Räume mit Mosaikdekor verfügt. So waren in der "Roman Villa" von
Knossos mindestens fünf am Peristyl gelegene Zimmer mit anspruchsvollen
Mosaiken ausgestattet. Nur schwer können wir uns an die Vorstellung
gewöhnen, daß all diese Räume ausschließlich für
Festgelage bestimmt gewesen sein sollen.
Der unzulängliche Publikationsstand und der disparate Charakter der
griechischen Pavimente erschweren den Versuch, Werkstattzusammenhänge
nachzuweisen und einzelne Stücke miteinander zu vergleichen. In der
technischen wie auch künstlerischen Ausführung herrschen erhebliche
Qualitätsunterschiede. Ebenso bereitet es Schwierigkeiten, Mosaiken
aufgrund ihrer Bildmotive zu Gruppen zusammenzuschließen.
Die Mosaizisten
besaßen bei der Kombination von Figurentypen und Bildthemen eine relativ
große Freiheit. So gibt es nur wenige übereinstimmende Repliken.
Häufiger finden sich Varianten eines Themas, die allerdings in Figurenzahl
und -typen erhebliche Unterschiede aufweisen.
Ausgesprochen wenige Mosaiken
können den Jahrhunderten um die Zeitenwende zugeordnet werden. Die
eigentliche Mosaikproduktion setzt offensichtlich erst im 2. Jh.n.Chr. ein.
In der Frühphase herrschen zunächst klare Formen und leicht überschaubare
Kompositionen vor. Selbst auf größeren Flächen wird ein
abrupter Wechsel verschiedener Dekorationssysteme vermieden. Die Darstellungen
sind in der Regel auf einen konkreten Themenbereich der antiken Ikonographie
festgelegt. Felder mit figürlichen Darstellungen haben meist den Charakter
eines Emblema. Sie sind von geometrischen Rahmenzonen durch kleinere Tessellae
und reichere Farbigkeit abgesetzt und auf einen relativ kleinen Ausschnitt
des Paviments beschränkt.
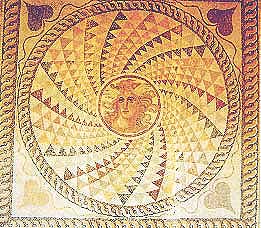
Aus dem Piräus stammt ein polychromes Mosaik, das aufgrund
des Befundes wahrscheinlich in die erste Hälfte des 2. Jhs. zu datieren
ist. Der Schmuck des Bodens besteht aus einem sog. Gorgonenschild. Die
Tessellae des äußeren Rahmens und geometrischen Musters sind
relativ groß (1-2.5cm) und ungleichmäßig gesetzt.
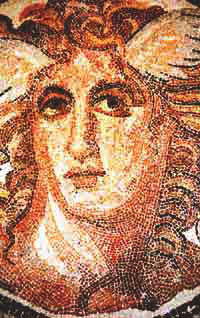
Umso mehr hebt sich das fein ausgearbeitete, zentrale Medaillon
vom übrigen Boden ab. Die Steinchen sind ca. 0.2-0.4cm groß und
dicht aneinandergereiht. Durch differenzierte Farbabstufungen wurde dem
Gesicht der Medusa Plastizität verliehen. Helle und dunkle Partien
gehen fließend ineinander über. Die Locken bestehen aus verschiedenfarbigen,
parallel verlaufenden Tessellaereihen.
Der Mosaizist bemühte sich um
die Wiedergabe von Details. So winden sich aus der Haarmasse mindestens
vier Schlangen, die schwarz gepunktet und mit Augenbraue, Pupille, Zunge
bzw. Bärtchen versehen sind. Auf den grauen Flügeln sind durch
gelbe Linien Federn angedeutet.
Es fällt auf, welche Sorgfalt auf schmückende
Einzelformen verwendet wurde.

Aus der bereits erwähnten "Villa Dionysos" in Knossos
stammen mehrere polychrome Mosaiken, die vermutlich in hadrianisch-antoninischer
Zeit entstanden sind. Ein Mosaik ist mit einem Hexagon- bzw. Wabenmuster
verziert. Im zentralen Feld befindet sich ein schelmisch blickender Satyr
mit einer Flöte.

Papposilen, Mänade, Pan und zwei weitere Satyrn umgeben
ihn. Die Büsten sind klar vom weißen Hintergrund abgesetzt. Es
dominieren Grau- und Rosatöne, auf denen blaue, grüne und gelbe
Steinchen leuchtende Akzente setzen. Konturlinien sind in Braunrot ausgearbeitet.
Im Gegensatz zum Medusamosaik aus dem Piräus wird hier stärker
mit Farbkontrasten gearbeitet. Details sind zwar summarischer angegeben,
doch wurde ein wirkungsvoller Gesamteindruck erzielt.

Auf einem anderen Mosaik des Hauses sticht die Büste
einer geflügelten Jahreszeitenpersonifikation durch ihre leuchtende
Polychromie ins Auge. Naturalistische Farbgebung wurde hier offensichtlich
nicht angestrebt. So sind schwarz eingefaßte Haarsträhnen mit
hellblauen und rosa Tessellareihen gefüllt. Dunkelrote Linien deuten
die Kontur von Nase und Kinn an.
Die Plastizität des Gesichts wird
durch eine effektvolle Gegenüberstellung von rosaweißen und beigegelben
Partien bewirkt. Die Augäpfel bestehen aus dunkelblauen Glassteinchen.
Bei
Korinth wurde eine reich ausgestattete Villa mit mehreren Mosaikböden
ausgegraben.
Der unzureichend publizierte Grabungsbefund liefert keinen
genaueren Datierungshinweis. Aufgrund von Vergleichen mit Mosaiken aus dem
römischen Germanien ist jedoch von einer Datierung in spätantoninische
Zeit auszugehen.

Der Mosaizist stellte sein Können insbesondere bei den
figürlichen Darstellungen unter Beweis.
Die Bildfelder sind als autonome
Gemälde aufgefaßt und heben sich in ihrer Farbigkeit und technischen
Ausführung deutlich von den rahmenden geometrischen Mustern ab.
Es
wurden keine Überschneidungen und perspektivischen Verkürzungen
gescheut. Im vollständig erhaltenen Genrebild finden sich auch landschaftliche
Elemente. Die stufenweise heller werdende Standfläche verschmilzt organisch
mit einem Berg im Hintergrund. An einen Baum lehnt sich ein Querflöte
spielender Satyr. Rechts dahinter grasen drei Rinder.


Trotz der hohen Qualität, verdeutlichen kleine Ungenauigkeiten
den handwerklichen Charakter dieses Mosaikbildes. Das liegende Rind in der
Mitte wurde offensichtlich später ausgeführt als das rechte, von
hinten gezeigte. Der Mosaizist versuchte, das Hinterteil des grauen Tieres
im verbleibenden Platz zwischen den Beinen seines braunen Artgenossen unterzubringen.
Der Rinderschwanz ist dabei unnatürlich gerundet und etwas sperrig nach vorne
gestreckt.
Auch die Überschneidungen von Baumstamm
und Satyr sind dem Mosaizisten nicht ganz gelungen. Zuerst wurde die menschliche
Figur fertiggestellt. Einige Details zeigen, daß man hierbei nicht
an den noch darzustellenden Baum dachte. So ist zwischen den Knien des Satyrs
und zwischen seinem linken Oberschenkel und dem herabhängenden Pantherfell
der weiße Hintergrund angegeben. Erst anschließend wurde der
Baum ausgeführt, dessen Form nun weitgehend durch die Kontur des nackten
Flötenspielers bestimmt war.
Seit dem Ende des 2. Jhs.n.Chr. läßt
die künstlerische Differenzierung einzelner Bodenabschnitte nach. Hauptbild,
Fries- und Rahmenzonen werden zunehmend gleichberechtigt behandelt. Im
Zentrum befindet sich häufig ein mehrfiguriges Gemälde, das zwar
durch Lage und Größe, aber nicht durch feinere Technik von den
Nebenfeldern und dem Rahmen abgesetzt ist. Es hat nur noch selten die Wirkung
eines Emblema. Auf Details wird immer weniger geachtet. Zugleich läßt
sich eine zunehmende Komplexität der Gliederungsschemata feststellen.
In vielen Fällen erfaßt der Betrachter die Komposition erst dann,
wenn er den Raum durchschritten hat. Formenvielfalt, Polychromie und dichte
Aneinanderreihung verschiedener Ornamente verleihen den Mosaiken eine lebhafte
Wirkung. Es wird ein effektvoller Gesamteindruck angestrebt.
Die figürlichen Darstellungen lassen Abwechslung und Originalität
erkennen. Typisch römische Bildthemen erleben einen Aufschwung, wobei
Arenakämpfe offensichtlich bevorzugt werden.

In einem öffentlichen Gebäude der antiken Stadt
Korinth wurde ein 9.03 x 7.62m großer Raum freigelegt, der wegen seines
Mosaikdekors als Büro der Schiedsrichter an den Isthmischen Spielen
interpretiert wurde. Aus stilistischen Gründen ist eine Datierung um 200 n.Chr. anzunehmen.
Das zentrale Bildfeld gibt einen nackten Athleten und die sitzende Personifikation
der Eutychia (Göttin des guten Schicksals) wieder. Der Körper
des Jünglings besteht aus kräftigen Muskeln, deren Massigkeit
durch kontrastreich eingesetzte Glanzlichter und dunkle Schattenzonen unterstrichen
wird.
Die parataktische Körperauffassung zeigt sich deutlich bei der
weiblichen Gestalt, deren Brüste aus kreisförmig angeordneten
Tessellaereihen gebildet sind und wie auf den nackten Oberkörper gelegte
Scheiben wirken. Auch die Gesichter scheinen aus Einzelformen zusammengesetzt,
denen der organische Zusammenhang fehlt. Zeichnerisch sind Augen, Mund und
Nase von dunklen Linien eingefaßt und deutlich vom hellen Inkarnat
abgehoben. Die Übergänge sind hier nicht mehr fließend wie
bei dem Medusakopf aus dem Piräus.


Im 3. Jh.n.Chr. erfreuen sich großformatige Tableaus
mit symmetrisch arrangierten Figurengruppen besonderer Beliebtheit. Dem
wachsenden Format der Bildfelder entsprechend, dehnen sich auch die dargestellten
Figuren aus und erreichen zum Teil fast Lebensgröße.
Auf einem
Mosaik in Thessaloniki sind drei Mosaikbilder U-förmig angeordnet.
Zwei kleinere, rechtwinklig zum großen Hauptbild orientierte Felder
rahmten wahrscheinlich eine weiß ausgesparte Fläche. Der Boden
konnte nicht vollständig ausgegraben werden, so daß sich die
ursprüngliche Ausdehnung und die Funktion des Raumes nicht mehr feststellen
ließen.
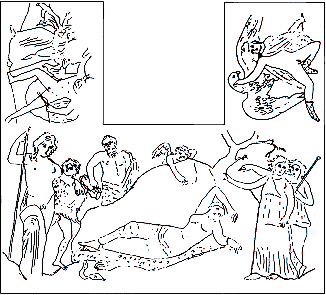
Das Mosaik gibt die amourösen Abenteuer von drei olympischen
Gottheiten wieder: Dionysos und Ariadne, Apollon und Daphne, Zeus und Ganymed.
Das größte Feld nimmt der Weingott mit seinem Gefolge ein. Dionysos,
der sich auf einen jungen Satyr stützt, und zwei aneinandergelehnte
Mänaden rahmen symmetrisch die schlafende Jungfrau. Im Hintergrund
ragen Eros und Papposilen hinter einem Felsen hervor. Die Figuren sind übersichtlich
nebeneinandergereiht und frontal auf den Betrachter ausgerichtet, ohne jedoch
in ein spannungsvolles Verhältnis zueinander zu treten. Die Mänaden
am rechten Bildrand zeigen zwar auf Ariadne, blicken jedoch in eine andere
Richtung. Selbst Dionysos schaut nicht direkt seine Geliebte an. Die Gestalten
sind in charakteristischen Posen wiedergegeben und wie auf einer Bühne
zu einem gefälligen Gruppenbild zusammengestellt.


Das Mosaik stammt von einem virtuosen Steinleger, der Körpern
und Gewändern durch ausgewogene Proportionen und subtile Schattengebung
Plastizität verlieh. Das Harmoniebedürfnis des Mosaizisten äußert
sich auch in der klaren Gliederung und symmetrischen Anlage der Komposition.
Bemerkenswert ist die sorgfältige Darstellung der einzelnen Figuren,
die feine Gesichtszeichnung und die dezente Andeutung der Wangenwölbung.
Bei einer Gegenüberstellung mit den dionysischen Köpfen aus der
"Villa Dionysos" in Knossos fällt allerdings die stärkere Linearität
auf. Besonders deutlich wird dies in der Augenpartie, wo Ober- und Unterlider
durch dunkelbraune Linien hart vom hellen Inkarnat abgesetzt sind.
Trotzdem
ist es erstaunlich, wie wenig sich die Technik innerhalb von etwa hundert
Jahren verändert hat.
Für viele Mosaiken des 3. Jhs.n.Chr. ist
eine gewisse Maßlosigkeit und Willkür bei der Auswahl und Zusammenstellung
verschiedener Sujets bezeichnend. Dionysische, aphrodisische, genrehafte
und realistische Motive werden scheinbar unüberlegt miteinander verbunden.
Es setzte sich das Bedürfnis durch, möglichst viele Botschaften
und optische Reize in einem Paviment zu vereinen. Nur schwer läßt
sich dieses Phänomen durch ein übergeordnetes Konzept, eine konkrete
Idee der Mosaizisten erklären. In dieser Zeit macht sich auch verstärkt
der Drang bemerkbar, die Darstellungen durch Beischriften zu erklären.
Seit der 2. Hälfte des 3. Jhs. treten auf Mosaiken häufiger Flüchtigkeitsfehler
und Verzeichnungen auf. Generell läßt sich ein zunehmender Qualitätsverlust
beobachten. Die Pavimente aus dem Haus des Menander in Mytilene können
aufgrund des Befundes in die 2. Hälfte des 3. Jhs.n.Chr. datiert werden.
Das Mosaik im Triclinium besteht aus zehn quadratischen Feldern mit figürlichen
Darstellungen, die anhand von Inschriften zweifelsfrei zu deuten sind.
An
der Südseite befindet sich ein Porträt des Dichters Menander.
Der etwa vierzigjährige Mann ist durch seinen konzentrierten Gesichtsausdruck
und die zahlreichen Falten als Denker charakterisiert. Der volle Mund, die
großen Augen und die relativ weichen Gesichtszüge deuten seine
Sensibilität und vielleicht auch seine Anfälligkeit gegenüber
Krankheiten an. Der linke Augapfel ist stark nach innen gerichtet und spielt
wahrscheinlich auf den in antiken Quellen erwähnten Strabismus des
Dichters an.
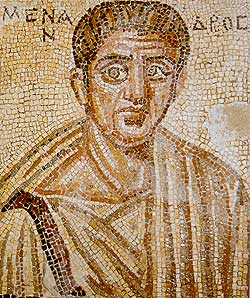
Der lineare Figurenstil hat sich hier vollkommen durchgesetzt.
Im Gesicht und am Hals sind die Einzelformen geometrisch stilisiert. Stirn
und Nase bilden zwei T-förmig angeordnete Rechtecke. Einem kreisförmigen
Umriß lassen sich Augen- und Mund-Kinn-Partie einschreiben, während
die Wangen eine dreieckige Form aufweisen. Auch auf dem Schlüsselbein
bilden konzentrisch angelegte Linien ein Dreieck. Die Frisur ist gegenüber
rundplastischen Menanderporträts stark vereinfacht und aus parallel
nach vorne gekämmten Haarsträhnen gebildet.
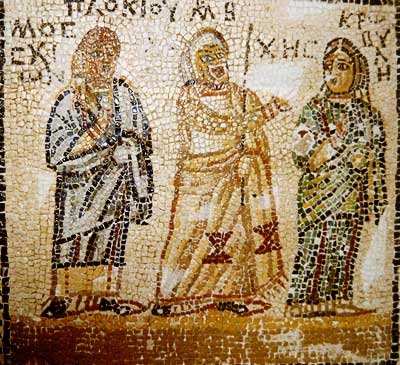
In einem westlich angrenzenden Feld ist eine Szene aus dem
2. Akt des Menanderstückes "Plokion" wiedergegeben. Es handelt sich
wahrscheinlich um die literarisch überlieferte Szene, in der Laches
mit seiner Frau Krobyle über Heiratspläne für den gemeinsamen
Sohn Moschion streitet.
Die Schauspieler tragen die für ihre Rolle
charakteristischen Gewänder und Masken. Sie sind frontal ausgerichtet
und weisen einen geschlossenen, nahezu rechteckigen Umriß auf. Ihre
Arme liegen eng am Körper an und werden von dem weiten Mantel größtenteils
verdeckt. Nur Laches weicht mit seinem erhobenen rechten Arm und der leichten
Rechtswendung vom starren Aufbau der Komposition ab.
Komplizierte Ansichten
und Überschneidungen sind vermieden. Die Füße sind bei allen
Figuren nach dem gleichen Schema angeordnet: ein Fuß ist frontal,
der andere im Profil wiedergegeben.
Anatomische Details sind sehr summarisch ausgeführt. So kann das Geschlecht
von Moschion und Krobyle in erster Linie anhand der Frisur und der Hautfarbe
, nicht jedoch anhand der Gesichtsbildung der Masken bestimmt werden.
In
der ersten Hälfte des 4. Jhs.n.Chr. ist kein tief einschneidender Stilwandel
in in der griechischen Mosaikkunst zu beobachten. Tendenzen des 3. Jhs.
werden ohne erkennbaren Bruch fortgesetzt. So läßt sich generell
eine fortschreitende Vergröberung der Technik und eine Zunahme von
Linearität und Flächigkeit beobachten. Großformatige Bildkompositionen
sind in dieser Zeit allerdings nur noch selten auf Bodenmosaiken in Griechenland
anzutreffen. Stattdessen werden kleinteilige Rapportmuster bevorzugt. Der
figürliche Dekor wird zunehmend auf den Wandschmuck verlagert.
Bei einer
Durchsicht der griechischen Mosaiken fällt auf, daß einige der
für italische Schwarzweißmosaiken charakteristischen Kompositions-
und Dekorationsprinzipien in Griechenland offensichtlich nicht Fuß
fassen konnten, z.B. der sog. style fleuri oder Arabeskenstil und vollkommen
freie Figurenkompositionen ohne erkennbares Gliederungsschema.
Das Themenrepertoire
der figürlichen Schwarzweißmosaiken in Griechenland ist auffallend
beschränkt. In Schwarzweißtechnik werden vorwiegend Motive aus
dem marinen Bereich dargestellt. Offensichtlich besteht hier eine Beziehung
zu Italien, wo die frühesten Schwarzweißmosaiken u.a. Delphine,
Seeungeheuer, Ichthyokentauren und schwimmende schwarze Afrikaner wiedergeben. Im Gegensatz
zu Italien werden in Griechenland kaum anspruchsvolle Kompositionen im Schwarzweißstil
verlegt.
Wie in den vorangehenden Ausführungen deutlich geworden ist, liegt
die Stärke der griechischen Werkstätten in der polychromen Technik.
Klar umgrenzte, leicht überschaubare Bildkompositionen werden eindeutig bevorzugt.
Verf., Symposion mit Menander und Dionysos. Römische Mosaiken
aus Griechenland, in: AntikeWelt 1997/4, Seite 309-318.
Abb. 2 nach S.Charitonidis - L. Kahil - R. Ginouvès,
in: VI. Beiheft Antike Kunst (1970); sonst Verf.